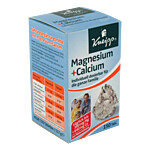Wirkungsweise
Wichtige Hinweise
Was sollten Sie beachten?
- Vorsicht bei Allergie gegen Korbblütler (lateinischer Name = Kompositen), z.B. Arnika, Ringelblume, Schafgarbe, Sonnenhut und Kamille!
- Vorsicht bei Allergie gegen Erdnüsse und Soja.
- Emulgatoren (z.B. Cetyl-/stearylalkohol) können Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.
Was sollten Sie beachten?
- Vorsicht bei Allergie gegen Korbblütler (lateinischer Name = Kompositen), z.B. Arnika, Ringelblume, Schafgarbe, Sonnenhut und Kamille!
- Vorsicht bei Allergie gegen Erdnüsse und Soja.
- Emulgatoren (z.B. Cetyl-/stearylalkohol) können Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.
Gegenanzeigen
Was spricht gegen eine Anwendung?
- Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe
Welche Altersgruppe ist zu beachten?
- Kinder unter 12 Jahren: Das Arzneimittel sollte in der Regel in dieser Altersgruppe nicht angewendet werden.
Was ist mit Schwangerschaft und Stillzeit?
- Schwangerschaft: Es gibt dazu keine Erkenntnisse. Lassen Sie sich im Zweifelsfalle von Ihrem Arzt oder Apotheker beraten.
- Stillzeit: Das Arzneimittel sollte nicht auf die Brust aufgetragen werden.
Ist Ihnen das Arzneimittel trotz einer Gegenanzeige verordnet worden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Der therapeutische Nutzen kann höher sein, als das Risiko, das die Anwendung bei einer Gegenanzeige in sich birgt.
Was spricht gegen eine Anwendung?
- Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe
Welche Altersgruppe ist zu beachten?
- Kinder unter 12 Jahren: Das Arzneimittel sollte in der Regel in dieser Altersgruppe nicht angewendet werden.
Was ist mit Schwangerschaft und Stillzeit?
- Schwangerschaft: Es gibt dazu keine Erkenntnisse. Lassen Sie sich im Zweifelsfalle von Ihrem Arzt oder Apotheker beraten.
- Stillzeit: Das Arzneimittel sollte nicht auf die Brust aufgetragen werden.
Ist Ihnen das Arzneimittel trotz einer Gegenanzeige verordnet worden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Der therapeutische Nutzen kann höher sein, als das Risiko, das die Anwendung bei einer Gegenanzeige in sich birgt.
Nebenwirkungen
Welche unerwünschten Wirkungen können auftreten?
- Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, wie:
- Hautreizung
- Hautausschlag
Bemerken Sie eine Befindlichkeitsstörung oder Veränderung während der Behandlung, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Für die Information an dieser Stelle werden vor allem Nebenwirkungen berücksichtigt, die bei mindestens einem von 1.000 behandelten Patienten auftreten.
Welche unerwünschten Wirkungen können auftreten?
- Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, wie:
- Hautreizung
- Hautausschlag
Bemerken Sie eine Befindlichkeitsstörung oder Veränderung während der Behandlung, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Für die Information an dieser Stelle werden vor allem Nebenwirkungen berücksichtigt, die bei mindestens einem von 1.000 behandelten Patienten auftreten.
Anwendungsgebiete
- Sport- und Unfallverletzungen, wie:
- Blutergüsse
- Prellungen und Verstauchungen
- Quetschungen
- Schmerzhafte Schwellungen nach Verletzungen
- Rheumatische Beschwerden, unterstützende Behandlung, v.a. in den Muskeln und Gelenken
- Entzündungen von Insektenstichen
Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn zusätzlich Beschwerden wie Rötung, Schwellung oder Überwärmung der Gelenke auftreten.
- Sport- und Unfallverletzungen, wie:
- Blutergüsse
- Prellungen und Verstauchungen
- Quetschungen
- Schmerzhafte Schwellungen nach Verletzungen
- Rheumatische Beschwerden, unterstützende Behandlung, v.a. in den Muskeln und Gelenken
- Entzündungen von Insektenstichen
Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn zusätzlich Beschwerden wie Rötung, Schwellung oder Überwärmung der Gelenke auftreten.
Was ist das? - Definition
Menisken sind druckausgleichende Knorpelscheiben im Kniegelenk. Bei einer Verletzung des Meniskus kommt es meist zu einem Riss im Knorpel.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Meniskusläsion
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Die Menisken sind zwei halbmondförmige Knorpelscheiben (Innen- und Außenmeniskus). Sie liegen wie dämpfende Polster zwischen der unteren Gelenkfläche des Kniegelenks, die vom Schienbein und der oberen Gelenkfläche, die vom Oberschenkelknochen gebildet wird. Die Menisken verbessern die Stabilität des Kniegelenks und dienen der zusätzlichen Druckabfederung.
Meist entstehen Meniskusverletzungen durch gewaltsame Drehbewegungen bei gebeugtem Kniegelenk. Dabei werden die Menisken stark belastet und es kann zu Einrissen kommen. Liegen altersbedingte Schäden der Menisken vor, können schon normale Bewegungen wie Aufstehen aus der Hocke oder wie das Einsteigen ins Auto zur Meniskusverletzung führen.
Der Innenmeniskus ist häufiger betroffen, denn er ist mit der Gelenkkapsel fest verbunden und kann sich bei starker Belastung nicht verschieben.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Die Betroffenen bemerken einen einschießenden Schmerz ins Kniegelenk. Da sich Teile des gerissenen Meniskus ins Kniegelenk einklemmen, kann es nicht mehr gestreckt werden. Das Knie wird dick, denn es bildet sich rasch eine Wasseransammlung im Kniegelenk, ein Gelenkerguss.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Das Kniegelenk muss geschont und gekühlt werden. Dann lassen die Beschwerden rasch nach. Wird der Meniskusschaden allerdings nicht operativ behoben, kommt es immer wieder zu Meniskuseinklemmungen im Kniegelenk mit Gelenkergüssen. Jede Einklemmung führt zu kleinen Schäden am Gelenkknorpel des Kniegelenkes. Diese Verletzungen heilen nur sehr schlecht. Folge ist daher eine zunehmende Abnutzung des Knorpels. Dies führt zum Gelenkverschleiß, der sehr schmerzhaften Arthrose.
Was rät die Großmutter? - Hausmittel und Verhaltenstipps
- bei einer akuten Meniskusverletzung sollte man das Knie hochlagern, schonen und lokal kühlen bis ein Arzt aufgesucht werden kann.
Bearbeitungsstand: 25.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Von einer Prellung spricht der Arzt, wenn ein direkter Schlag, z.B. ein Tritt beim Fußballspielen, gegen ein Gelenk oder eine sonstige Körperregion stattfindet.
Eine Zerrung dagegen entsteht zum Beispiel, wenn man einen "Fuß übertritt". Hier hat also keine direkte Gewalt eingewirkt, sondern es kommt durch eine indirekte Belastung zur Schädigung des Gelenks oder der Muskeln.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Kontusion ist der medizinische Fachausdruck für Prellung.
- Distorsion ist der medizinsche Fachausdruck für Dehnung, Überdehnung, Verstauchung.
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Bei einem direkten Schlag kommt es durch den Druck auf das Gewebe zur Weichteilschwellung oder gar zum Bluterguss. Deshalb kann auch schon eine leichte Prellung erhebliche Schmerzen verursachen.
Eine Zerrung ist Folge eines indirekten Traumas, also z.B. einer Überbelastung der Muskeln, wenn man beispielsweise untrainiert Fußball spielt oder sich vor dem Sport nicht richtig aufgewärmt hat. Die Muskeln bestehen aus einzelnen Zellen, den so genannten Muskelfasern. Bei einer Zerrung reißen einzelne dieser Muskelfasern, man spricht deshalb auch vom Muskelfaserriss.
Eine Gelenkzerrung entsteht durch eine Überdehnung der Gelenkbänder.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Bei Zerrung und Prellung kommt es zu ganz ähnlichen Beschwerden:
- Die betroffene Körperregion schmerzt, Folge ist eine schmerzbedingte Funktionseinschränkung (z.B. Humpeln).
- Je nach Stärke der Verletzung kommt es zu einer lokalen Schwellung, eventuell mit Bluterguss.
- Besonders bei der Prellung eines großen Gelenkes, z.B. des Kniegelenks, führen Prellung oder Zerrung zum Gelenkerguss, das heißt einer Flüssigkeitsansammlung im Gelenk.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Zerrungen und Prellungen heilen immer folgenlos aus.
Es dauert allerdings oft recht lange, bis alles abgeheilt ist. Die Beschwerden bleiben oft länger bestehen wie bei einem Knochenbruch.
Was kann dahinter stecken - Mögliche Krankheitsbilder
Eine starke Prellung kann zum Knochenbruch führen, daher wird im Zweifelsfall immer geröntgt.
Bei einer starken Überdehnung oder Zerrung der Gelenkbänder ist immer ein Bänderriss auszuschließen. Hierfür sind spezielle Röntgenaufnahmen erforderlich.
Was rät die Großmutter? - Hausmittel und Verhaltenstipps
- Die lokale Kühlung der betroffenen Region führt zum Rückgang der Schwellung und wirkt daher schmerzlindernd.
- Sind Muskeln oder Gelenke betroffen, sollten diese wenn möglich zusätzlich hochgelagert werden, um eine Zunahme der Schwellung zu verhindern.
- Die Schonung der Muskeln, Gelenke oder anderer betroffener Körperstellen ist natürlich auch hilfreich.
- Johannisöl lokal aufgetragen wirkt lindernd.
Bearbeitungsstand: 02.11.2021
Quellenangaben:
Mutschler, Arzneimittelwirkungen, Wiss.Verl.-Ges., (2008), Aufl. 9 - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Quetschwunden entstehen durch mechanische Gewalteinwirkungen, die das Gewebe von 2 Seiten zusammenpressen (ähnlich wie eine Zange).
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursachen und deren Vermeidung
Kleinere Quetschwunden entstehen meist durch Abrutschen mit zangenähnlichen Werkzeugen, vorzugsweise an den Händen und Fingern. In Lagerhallen können auch andere Körperteile durch verrutschte Ladung eingeklemmt werden. Vermieden werden können diese Verletzungen durch konsequente Beachtung von Sicherheitsvorschriften und Beseitigung von Gefahrenquellen.
Wie sieht es aus? - Symptome und Merkmale
Quetschwunden bluten nach außen nicht oder nur sehr wenig. In der Tiefe können sich aber starke Blutungen bilden. Das gequetschte Gewebe schwillt an (Ödem), manchmal kann man großflächige Blutergüsse unter der Haut sehen. Quetschwunden sind äußerst schmerzhaft.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Die Gewebszerstörung unter der intakten Haut verursacht u.U. starke Blutungen und ist schwer zu beurteilen. Sind große Blutgefäße gerissen, kann ein Schock durch den großen Blutverlust entstehen. Ist für die Blutmenge nicht genügend Platz im Gewebe vorhanden, können durch den Druckanstieg die Blutzufuhr der Extremität abgeschnürt werden. Der Heilungsverlauf von Quetschwunden ist teilweise sehr langwierig.
Was muss man tun? - Erste Maßnahmen und Verhaltenstipps
Kühlung der Quetschwunde vermindert das Einbluten ins Gewebe und wirkt schmerzstillend. In der chirurgischen Ambulanz wird die Größe der Gewebszerstörung und der Blutverlust beurteilt. Durch Hochhalten der Wunde über Herzniveau wird ein weiteres Einbluten verringert. In Extremfällen muss operativ das Gewebe entlastet werden. Kleinere Quetschwunden werden durch einen festen Verband ruhiggestellt.
Was rät die Großmutter? - Hausmittel und Verhaltenstipps
- Kühlen Sie eine Quetschwunde lange.
- Öffnen Sie keine Blutblasen.
- Nach 1 bis 2 Tagen verbessern durchblutungsfördernde Salben den Abtransport des Blutes und die Wundheilung.
- Rufen Sie bei großflächigen Quetschwunden den Rettungsdienst.
Bearbeitungsstand: 19.10.2021
Quellenangabe:
Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Ein Bluterguss wird verursacht durch eine Einblutung ins Gewebe. Meist ist mit dem Begriff eine Einblutung in die Haut gemeint. Blutergüsse kommen aber auch in Gelenken, im Brust- und Bauchraum oder im und am Gehirn vor.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Hämatom
- Blauer Fleck
- Einblutung
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursachen
Ursache eines Blutergusses ist meist eine Prellung. Durch die stumpfe Gewalteinwirkung kommt es zur Zerreißung feinster Blutgefäße, so dass Blut ins Gewebe austreten kann.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Abhängig von der Ursache der Verletzung kann es zu einer ausgeprägten Schwellung der betroffenen Region kommen.
Körpereigene Zellen nehmen die Bestandteile der Blutzellen nur langsam auf. So lässt sich der Abbau des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin unter der Haut beobachten: Der Bluterguss färbt sich von Blau über Grün nach Braun-Gelb, das langsam verblasst, bis er schließlich ganz verschwunden ist.
Die meisten Blutergüsse verschwinden innerhalb weniger Tage von selbst.
Was kann dahinter stecken? - Mögliche Krankheitsbilder
Häufigste Ursachen für einen Bluterguss sind ein Sturz oder der Anprall der betroffenen Stelle an einem harten Gegenstand.
Auch nach medizinischen Eingriffen oder Punktionen wie der Blutabnahme gehören Blutergüsse zu den häufigen Nebenwirkungen.
Kommt es öfters und bei schon kleinen Verletzungen zu Blutergüssen, kann eine Krankheit des Gerinnungssystems dahinter stecken, zum Beispiel ein Mangel an Gerinnungsfaktoren wie bei der so genannten Bluterkrankheit (Hämophilie).
Auch die Einnahme von Medikamenten oder Naturstoffen, die die Blutgerinnung beeinflussen, kann die Bildung von Blutergüssen begünstigen. Der bekannteste und verbreitetste Wirkstoff ist Acetylsalicylsäure.
Verhaltenstipps
Bei Verletzungen gilt grundsätzlich: Sofort kühlen und den betroffenen Arm oder das Bein hoch lagern. Das vermindert die Entstehung von Schwellung und Bluterguss.
Ausführliches Abdrücken, etwa nach einer Blutabnahme verhindert einen Bluterguss.
Arnika, alkoholische oder heparinhaltige Salbenumschläge und Verbände lindern den Schmerz und können auch die Heilung beschleunigen.
In seltenen Fällen sind Blutergüsse so groß oder gefährlich, dass das geronnene Blut operativ entfernt werden muss, man spricht von einer Hämatomausräumung.
Bearbeitungsstand: 09.11.2021
Quellenangaben:
Moll, Dermatologie, (2010), 7. Auflage - Herold, Innere Medizin, Herold, (2011)
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Ein Bluterguss wird verursacht durch eine Einblutung ins Gewebe. Meist ist mit dem Begriff eine Einblutung in die Haut gemeint. Blutergüsse kommen aber auch in Gelenken, im Brust- und Bauchraum oder im und am Gehirn vor.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Hämatom
- Blauer Fleck
- Einblutung
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursachen
Ursache eines Blutergusses ist meist eine Prellung. Durch die stumpfe Gewalteinwirkung kommt es zur Zerreißung feinster Blutgefäße, so dass Blut ins Gewebe austreten kann.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Abhängig von der Ursache der Verletzung kann es zu einer ausgeprägten Schwellung der betroffenen Region kommen.
Körpereigene Zellen nehmen die Bestandteile der Blutzellen nur langsam auf. So lässt sich der Abbau des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin unter der Haut beobachten: Der Bluterguss färbt sich von Blau über Grün nach Braun-Gelb, das langsam verblasst, bis er schließlich ganz verschwunden ist.
Die meisten Blutergüsse verschwinden innerhalb weniger Tage von selbst.
Was kann dahinter stecken? - Mögliche Krankheitsbilder
Häufigste Ursachen für einen Bluterguss sind ein Sturz oder der Anprall der betroffenen Stelle an einem harten Gegenstand.
Auch nach medizinischen Eingriffen oder Punktionen wie der Blutabnahme gehören Blutergüsse zu den häufigen Nebenwirkungen.
Kommt es öfters und bei schon kleinen Verletzungen zu Blutergüssen, kann eine Krankheit des Gerinnungssystems dahinter stecken, zum Beispiel ein Mangel an Gerinnungsfaktoren wie bei der so genannten Bluterkrankheit (Hämophilie).
Auch die Einnahme von Medikamenten oder Naturstoffen, die die Blutgerinnung beeinflussen, kann die Bildung von Blutergüssen begünstigen. Der bekannteste und verbreitetste Wirkstoff ist Acetylsalicylsäure.
Verhaltenstipps
Bei Verletzungen gilt grundsätzlich: Sofort kühlen und den betroffenen Arm oder das Bein hoch lagern. Das vermindert die Entstehung von Schwellung und Bluterguss.
Ausführliches Abdrücken, etwa nach einer Blutabnahme verhindert einen Bluterguss.
Arnika, alkoholische oder heparinhaltige Salbenumschläge und Verbände lindern den Schmerz und können auch die Heilung beschleunigen.
In seltenen Fällen sind Blutergüsse so groß oder gefährlich, dass das geronnene Blut operativ entfernt werden muss, man spricht von einer Hämatomausräumung.
Bearbeitungsstand: 09.11.2021
Quellenangaben:
Moll, Dermatologie, (2010), 7. Auflage - Herold, Innere Medizin, Herold, (2011)
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Unter Bänderriss versteht der Arzt, wenn Gelenkbänder reißen. Meist geschieht dies als Folge einer Verletzung, bei der das Gelenk stark überdehnt wird.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Bandruptur
- Ligamentruptur
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Bänder finden sich in unserem Körper besonders an den Gelenken und dienen zur zusätzlichen Stabilisierung. Sie bestehen aus einem sehr festen Gewebe. Doch wenn sie überbeansprucht werden, wenn das Gelenk zum Beispiel ruckartig überdehnt wird (Umknicken im Sprunggelenk), können sie reißen. Da die Bänder oft fester als Knochen sind, kann das Band nicht nur irgendwo in der Mitte, sondern auch an seiner Ansatzstelle am Knochen reißen und dabei ein Stück Knochen mit ausbrechen.
Auf Grund der hohen mechanischen Beanspruchung, kommt es besonders in den Beingelenken zu Bänderrissen. Am häufigsten betroffen sind das Kniegelenk und die äußeren Bänder des Sprunggelenkes.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Das betroffene Gelenk ist stark geschwollen und schmerzt bei Berührung oder Belastung. Nicht selten bildet sich lokal ein Bluterguss. Bei der auslösenden Verletzung kann man manchmal sogar einen Schnalzlaut hören.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Wachsen die Bänder nicht vollständig zusammen, kann es zur Instabilität im Gelenk kommen, man spricht vom "Schlottergelenk". Beim Sprunggelenk sieht es dann zum Beispiel so aus, dass man sehr leicht umknickt. Folge ist ein schnellerer Gelenksverschleiß und somit eine Arthrose.
Was kann sonst noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Um einen Knochenbruch auszuschließen sollte das betroffene Gelenk immer geröntgt werden. Eine Kniespiegelung (Arthroskopie) wird bei Bandverletzungen im Knie empfohlen, um das genaue Ausmaß der Bandverletzung festzustellen.
Hausmittel und Verhaltenstipps
- Zusätzlich zur Therapie (Operation oder Gipsschiene) sollte das Gelenk gekühlt, hochgelagert und natürlich geschont werden.
- Bei entsprechenden Sportarten (z.B. Volleyball, Basketball) ist auf gelenkschützendes Schuhwerk zu achten.
Bearbeitungsstand: 22.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Menisken sind druckausgleichende Knorpelscheiben im Kniegelenk. Bei einer Verletzung des Meniskus kommt es meist zu einem Riss im Knorpel.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Meniskusläsion
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Die Menisken sind zwei halbmondförmige Knorpelscheiben (Innen- und Außenmeniskus). Sie liegen wie dämpfende Polster zwischen der unteren Gelenkfläche des Kniegelenks, die vom Schienbein und der oberen Gelenkfläche, die vom Oberschenkelknochen gebildet wird. Die Menisken verbessern die Stabilität des Kniegelenks und dienen der zusätzlichen Druckabfederung.
Meist entstehen Meniskusverletzungen durch gewaltsame Drehbewegungen bei gebeugtem Kniegelenk. Dabei werden die Menisken stark belastet und es kann zu Einrissen kommen. Liegen altersbedingte Schäden der Menisken vor, können schon normale Bewegungen wie Aufstehen aus der Hocke oder wie das Einsteigen ins Auto zur Meniskusverletzung führen.
Der Innenmeniskus ist häufiger betroffen, denn er ist mit der Gelenkkapsel fest verbunden und kann sich bei starker Belastung nicht verschieben.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Die Betroffenen bemerken einen einschießenden Schmerz ins Kniegelenk. Da sich Teile des gerissenen Meniskus ins Kniegelenk einklemmen, kann es nicht mehr gestreckt werden. Das Knie wird dick, denn es bildet sich rasch eine Wasseransammlung im Kniegelenk, ein Gelenkerguss.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Das Kniegelenk muss geschont und gekühlt werden. Dann lassen die Beschwerden rasch nach. Wird der Meniskusschaden allerdings nicht operativ behoben, kommt es immer wieder zu Meniskuseinklemmungen im Kniegelenk mit Gelenkergüssen. Jede Einklemmung führt zu kleinen Schäden am Gelenkknorpel des Kniegelenkes. Diese Verletzungen heilen nur sehr schlecht. Folge ist daher eine zunehmende Abnutzung des Knorpels. Dies führt zum Gelenkverschleiß, der sehr schmerzhaften Arthrose.
Was rät die Großmutter? - Hausmittel und Verhaltenstipps
- bei einer akuten Meniskusverletzung sollte man das Knie hochlagern, schonen und lokal kühlen bis ein Arzt aufgesucht werden kann.
Bearbeitungsstand: 25.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Es handelt sich um eine schwere Gelenkverletzung, bei der die gelenkbildenden Knochen den Kontakt vollständig verloren haben. Oft ist auch von einem ausgekugelten Gelenk die Rede.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Luxation
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Damit wir unsere Knochen bewegen können, gibt es mehrere hundert gelenkige Verbindungsstellen zwischen jeweils zwei Knochen. Die Gelenkflächen der Knochen sind mit Knorpel überzogen. Um das Gelenk zusammenzuhalten, ist es mit einer festen Gelenkkapsel und Gelenkbändern überzogen.
Im Rahmen eines schweren Sturzes können die Gelenkkapsel und die Gelenkbänder zerreißen. Das Gelenk ist nicht mehr stabil und die Gelenkflächen haben den direkten Kontakt verloren.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Am häufigsten verrenkt (luxiert) das Schultergelenk. Die Schulter ist neben dem Hüftgelenk unser beweglichstes Gelenk. Das Hüftgelenk hat eine sehr hohe Stabilität durch ein gutes Knochengebilde, der Hüftkopf lagert gesichert in einer tiefen Gelenkpfanne. Im Gegensatz dazu ist das Schultergelenk hauptsächlich durch ein dichtes Muskelgeflecht gesichert, denn der Oberarmkopf liegt nur einer sehr flachen Gelenkpfanne auf. Wenn bei einem Sturz die Gelenkkapsel und die Gelenkbänder reißen, können die Muskeln das Gelenk nicht mehr zusammenhalten und das Schultergelenk kugelt aus.
Eine Verrenkung oder Luxation hat folgende typische Kennzeichen:
- Eine deutliche Fehlstellung des Gelenkes
- Unbeweglichkeit des Gelenkes
- Ist das Schultergelenk betroffen: Eine tastbare Lücke im Bereich des Oberarmkopfes
- Ist es durch die Verrenkung zu einer Nerven- oder Gefäßverletzung gekommen: Gefühlsstörungen oder ein deutlicher Bluterguss in der Umgebung des Gelenkes.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Durch gekonnten Zug am Gelenk kann ein Arzt die Knochen und somit auch die Gelenkflächen wieder in die richtige Stellung zueinander bringen. Das Gelenk wird für einige Tage mit einem Verband oder Gips ruhig gestellt. Meist heilen die Verletzungen folgenlos aus.
Wachsen die Gelenkkapsel und -bänder nicht vollständig zusammen, kann sich eine dauerhafte Instabilität des Gelenkes entwickeln. Folge sind häufige Verrenkungen des Gelenkes, die schon bei ungeschickten Bewegungen, z.B. beim Mantel anziehen auftreten können. Bei jeder Gelenkverrenkung kommt es zu kleinen Schäden am Gelenkknorpel. Diese Verletzungen heilen nur sehr schlecht. Folge ist daher eine zunehmende Abnutzung des Knorpels. Dies führt zum Gelenkverschleiß, der sehr schmerzhaften Arthrose. Daher sollte ein instabiles Gelenk operiert werden.
Was kann sonst noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Zu einer Verrenkung kann es auch im Rahmen eines Knochenbruchs kommen, daher sollte eine Gelenkverrenkung immer geröntgt werden, bevor man die Knochen wieder einrenkt.
Verhaltenstipps
- Bei Verdacht auf eine Gelenkverrenkung sollte man nicht versuchen, das Gelenk selbst einzurenken, sondern immer ärztliche Hilfe anfordern.
Bearbeitungsstand: 25.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Andreae, von Hayek, Weniger, Krankheitslehre für Altenpflege, Thieme, (2006) - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Quetschwunden entstehen durch mechanische Gewalteinwirkungen, die das Gewebe von 2 Seiten zusammenpressen (ähnlich wie eine Zange).
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursachen und deren Vermeidung
Kleinere Quetschwunden entstehen meist durch Abrutschen mit zangenähnlichen Werkzeugen, vorzugsweise an den Händen und Fingern. In Lagerhallen können auch andere Körperteile durch verrutschte Ladung eingeklemmt werden. Vermieden werden können diese Verletzungen durch konsequente Beachtung von Sicherheitsvorschriften und Beseitigung von Gefahrenquellen.
Wie sieht es aus? - Symptome und Merkmale
Quetschwunden bluten nach außen nicht oder nur sehr wenig. In der Tiefe können sich aber starke Blutungen bilden. Das gequetschte Gewebe schwillt an (Ödem), manchmal kann man großflächige Blutergüsse unter der Haut sehen. Quetschwunden sind äußerst schmerzhaft.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Die Gewebszerstörung unter der intakten Haut verursacht u.U. starke Blutungen und ist schwer zu beurteilen. Sind große Blutgefäße gerissen, kann ein Schock durch den großen Blutverlust entstehen. Ist für die Blutmenge nicht genügend Platz im Gewebe vorhanden, können durch den Druckanstieg die Blutzufuhr der Extremität abgeschnürt werden. Der Heilungsverlauf von Quetschwunden ist teilweise sehr langwierig.
Was muss man tun? - Erste Maßnahmen und Verhaltenstipps
Kühlung der Quetschwunde vermindert das Einbluten ins Gewebe und wirkt schmerzstillend. In der chirurgischen Ambulanz wird die Größe der Gewebszerstörung und der Blutverlust beurteilt. Durch Hochhalten der Wunde über Herzniveau wird ein weiteres Einbluten verringert. In Extremfällen muss operativ das Gewebe entlastet werden. Kleinere Quetschwunden werden durch einen festen Verband ruhiggestellt.
Was rät die Großmutter? - Hausmittel und Verhaltenstipps
- Kühlen Sie eine Quetschwunde lange.
- Öffnen Sie keine Blutblasen.
- Nach 1 bis 2 Tagen verbessern durchblutungsfördernde Salben den Abtransport des Blutes und die Wundheilung.
- Rufen Sie bei großflächigen Quetschwunden den Rettungsdienst.
Bearbeitungsstand: 19.10.2021
Quellenangabe:
Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Rheuma ist keine einzelne Krankheit sondern ein Sammelbegriff für mehr als hundert verschiedene Erkrankungen. Landläufig werden darunter vor allem Erkrankungen verstanden, die mit Schmerzen an Gelenken, Sehnen und Muskeln verbunden sind.
Im medizinischen Gebrauch gehören zu den rheumatischen Erkrankungen jedoch auch Krankheitsbilder, bei denen das Bindegewebe, innere Organe oder Blutgefäße betroffen sind.
Was wird alles darunter verstanden? - Dazugehörige Krankheitsbilder
Je nach zu Grunde liegender Ursache unterscheidet man beim Rheuma zwischen:
- Den degenerativ-rheumatischen Krankheiten: Dazu zählt die Arthrose, also der Gelenkverschleiß.
- Dem so genannten Weichteilrheumatismus: Dabei stehen Schmerzen an Sehnen, Bändern oder Muskeln im Vordergrund.
- Den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen: Dazu gehört z.B. die chronische Polyarthritis oder der Morbus Bechterew. Zu beachten ist, dass die Mediziner darunter auch Krankheiten einordnen, die die Gelenke erst später, evtl. auch gar nicht befallen, sondern vor allem die Blutgefäße, das Bindegewebe oder innere Organe. Beispiele dafür sind der so genannte Lupus erythematodes oder die Sklerodermie. Gemeinsam ist allen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen eine Störung des Immunssystems. Die Gelenke, die Blutgefäße, das Bindegewebe oder andere Organe werden dabei vom körpereigenen Abwehrsystem angegriffen und zerstört.
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Um die Bewegungen von zwei Knochenenden gegeneinander im Gelenk zu ermöglichen, sind die Gelenkflächen mit einer Knorpelschicht überzogen. Zwischen den Gelenkflächen findet sich ein schmaler Gelenkspalt, der mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. So können sich die Knochen reibungsfrei bewegen. Damit das Gelenk nicht auseinandergezogen wird, ist es von einer Gelenkkapsel überzogen. Die Innenhaut dieser Gelenkkapsel nennt man Synovia. Sie bildet Nährstoffe für den Gelenkknorpel, welcher keine eigenen Blutgefäße hat und sich deshalb bei Verletzungen nicht neu bilden kann.
Bei den entzündlich-rheuamtischen Erkrankungen, die die Gelenke betreffen liegt eine chronische Entzündung der Gelenkinnenhaut zu Grunde. Diese chronische Entzündung kann auch auf innere Organe wie Herz oder Lunge übergreifen. Die genaue Ursache der einzelnen rheumatischen Erkrankungen ist in den meisten Fällen unbekannt, oft sind sie vererbt.
Die Arthrose dagegen entwickelt sich im Rahmen einer zunehmenden Abnutzung des Gelenkknorpels. Zu einer Überbeanspruchung der Gelenke kann es auf Grund starken Übergewichts, einer Fehlstellung der Gelenke oder im Alter kommen. Entwickelt sich schon in jungen Jahren eine Arthrose, so liegt die Ursache in einem angeborenen Defekt des Gelenkknorpels.
Auch die Ursache des Weichteilrheumatismus ist unklar, man vermutet, dass hier psychische Einflüsse eine Rolle spielen.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Auf den ersten Blick scheint es klar: Hat jemand "Rheuma", dann hat er Schmerzen im Bewegungs- oder Stützapparat. Bei genauerem Betrachten unterscheiden sich die Beschwerden aber doch:
- Bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen ist die Gelenkinnenhaut, die Synovia, entzündet. Deshalb stehen hier schmerzhafte Gelenkschwellungen, besonders der kleinen Fingergelenke im Vordergrund.
- Liegt eine Gelenkabnutzung vor, beklagen die Betroffenen Schmerzen bei Gelenkbelastung, also zum Beispiel beim Gehen. Typischerweise sind die ersten Schritte am schmerzhaftesten, man spricht vom Anlaufschmerz.
- Da beim Weichteilrheumatismus die Bänder, Muskeln und Sehnen der Gelenke entzündet sind, werden hier generalisierte Schmerzen ("mir tut alles weh") beklagt.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Der Verlauf sieht, je nachdem, was dahinter steckt, unterschiedlich aus:
- Die chronische Entzündung der Gelenkinnenhaut bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen kann zur Zerstörung der Gelenke mit Einsteifung und Fehlstellung führen. In extremen Fällen greift die Erkrankung auf innere Organe über und schädigt zum Beispiel das Herz, die Gefäße oder die Haut.
- Schreitet eine Arthrose fort, wird jeder Schritt schmerzhaft, in extremen Fällen schmerzen die Gelenke sogar in Ruhe.
- Beim Weichteilrheumatismus kommt es nicht zu dauerhaften Schäden an den betroffenen Strukturen. Doch sind die Betroffenen durch die ständigen Schmerzen oft psychisch sehr belastet.
Was kann noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Entzündungen einzelner Gelenke können auch durch Bakterien ausgelöst sein, die im Rahmen einer Viruserkrankung oder im Zuge anderer chronischer Erkrankungen auftreten. In allen drei Fällen spricht man von einer Arthritis.
Beim Gichtanfall, einer Entzündung, die durch Harnsäurekristallen im Gelenk verursacht wird, ist typischerweise das Großzehengelenk befallen. Meist geht dem Gichtanfall ein Festessen mit viel Fleisch und Alkoholgenuss voraus. Danach ist der Harnsäurespiegel im Blut erhöht, wodurch ein Gichtanfall ausgelöst werden kann.
An ein rheumatisches Fieber muss man bei Kindern oder Jugendlichen denken, die nach einer eitrigen Mandelentzündung hohes Fieber haben und über starke Gelenkschmerzen klagen. Da eine Mandelentzündung heute in der Regel mit Antibiotika behandelt wird, ist das rheumatische Fieber jedoch sehr selten geworden.
Was rät die Großmutter? - Hausmittel und Verhaltenstipps
- Bei entzündeten Gelenken wirken kühlende Umschläge lindernd.
- Eine Arthrose dagegen lässt sich eher durch lokale Wärme mildern.
- Entzündete und abgenutzte Gelenke sollten entlastet werden, zum Beispiel durch die vorübergehende Nutzung einer Gehhilfe.
- Liegt ein Gelenkverschleiß vor, kann man durch Gewichtsabnahme und regelmäßige leichte körperliche Tätigkeit, zum Beispiel Schwimmen, die Beweglichkeit der Gelenke bessern.
- Kommt es wiederholt zu Schwellungen und Entzündungen der Fingergelenke, sollte zur weiteren Abklärung ein Arzt zu Rate gezogen werden.
Bearbeitungsstand: 21.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Andreae, von Hayek, Weniger, Krankheitslehre für Altenpflege, Thieme, (2006) - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage - Herold, Innere Medizin, Herold, (2011)
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Als Weichteile werden die Strukturen bezeichnet, welche die Gelenke umgeben, also Muskeln, Bänder, Sehnen und Sehnenscheiden. Kommt es zu Entzündungen, Reizungen oder Verkrampfungen dieser Strukturen, spricht man von Weichteilrheumatismus.
Wie wird es noch genannt? - Andere Bezeichnungen
- Nichtartikuläre Rheumaformen
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursache
Zu den schmerzhaften Veränderungen der Weichteile kommt es infolge von Fehlhaltungen, einer Überbelastung einzelner Muskelgruppen oder Verspannungen. Es besteht eine enge Beziehung zwischen Psyche und der Körperhaltung. Ängste, Depressionen, aber auch Aggressionen lösen Muskelverspannungen aus und sind somit eine häufige Ursache der Beschwerden.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Typisch sind plötzliche Schmerzen im Bereich der überbelasteten Muskulatur oder der Sehnen.
Die Betroffenen klagen über schmerzhafte Muskelverspannungen oder über Bewegungsschmerzen an bestimmten Sehnenansatzpunkten. Meist treten die Muskelverspannungen im Bereich der Schultermuskulatur oder entlang der Wirbelsäule auf. Der betroffene Muskel ist verhärtet und sehr druckschmerzhaft.
Eine ausgeprägte Form des Weichteilrheumatismus ist die Fibromyalgie. Es kommt, meist auf Grund unklarer Ursache, zu generellen Schmerzen im ganzen Bewegungsapparat.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Unter entsprechender Behandlung klingen die Muskelschmerzen meist rasch ab. Lässt sich die auslösende Ursache aber nicht beseitigen, können die Beschwerden immer wieder auftreten.
Was kann noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Einer Sehnenscheidenentzündung liegt meist eine Überbelastung bestimmter Sehnen, besonders am Unterarm zu Grunde. Ursache ist meist eine einseitige Belastung.
Beim so genannten "Tennisellbogen" oder "Tennisarm" ist es zu einer Reizung der Ansatzstelle der Unterarmsehne am Ellenbogen gekommen.
Bei der Polymyalgia rheumatica handelt es sich um entzündlich bedingte Muskelschmerzen im Schulter- und Beckenbereich. Es ist eine Erkrankung der älteren Menschen und kann mit einer Gefäßentzündung einhergehen.
Was rät die Großmutter? - Hausmittel und Verhaltenstipps
- Lokale Wärme wirkt muskelentspannend und somit schmerzlindernd.
- Sind die Sehnen überlastet, ist nicht selten eine vorübergehende Ruhigstellung nötig.
- Entspannungsübungen oder psychotherapeutische Maßnahmen helfen, wenn psychische Ursachen den Beschwerden zu Grunde liegen.
- In körperlich schweren Berufen sind Muskelverspannungen sehr häufig. Deshalb ist hier die richtige Arbeitsweise zur Muskelentlastung wichtig.
Bearbeitungsstand: 25.10.2021
Quellenangaben:
Thews, Mutschler, Vaupel, Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen, WVG, (2007), 5. Aufl. - Brunkhorst, Schölmerich, Differenzialdiagnostik und Differenzialtherapie, Elsevier (Urban & Fischer), (2010), 1. Auflage - Wülker, Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme, (2009), 2. Auflage - Arolt, Reimer, Dilling, Basiswissen Psychiatrie und Psychotherpaie, Springer, (2011), 7. Auflage - Herold, Innere Medizin, Herold, (2011)
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist das? - Definition
Die meisten Insektenstiche führen zu mehr oder weniger schmerzhaften und juckenden Rötungen und Schwellungen, in denen manchmal noch der Stachel des Insekts steckt. Es finden sich einzelne oder mehrere Einstichstellen. Besonders gefährlich sind Stiche im Lippenbereich oder im Mund-Rachenraum.
Wie kommt es dazu? - Mögliche Ursachen
Es gibt viele Insekten, die stechen können. Häufig sind es Bienen, Wespen und Mücken, aber auch Spinnen und Ameisen, Bremsen und Flöhe. Wenn ein Insekt gestochen hat, gelangt ein artspezifisches Gift (Toxin) in den Organismus. Es enthält Eiweiße, die für die Schmerzwirkung verantwortlich sind und eine Entzündungsreaktion des Organismuses auslösen. Blutgefäße erweitern sich, dadurch kommt es zu einer Rötung der Haut. Ausgetretene Flüssigkeit sammelt sich im Gewebe und führt zur Schwellung, die Haut spannt. Die Eiweißstoffe des Giftes bewirken das Freisetzen körpereigener Botenstoffe, wie das Histamin, das unter anderem verantwortlich ist für den Juckreiz.
Wie macht es sich bemerkbar? - Symptome
Der Stich eines Insekts ruft zunächst einen stechenden Schmerz hervor. Innerhalb kurzer Zeit rötet sich die Einstichstelle, sie schwillt an und kann eine Quaddel (Hauterhebung) bilden. Etwas später fängt der Juckreiz an.
Wie geht es weiter? - Verlauf und Komplikationen
Normalerweise sind die Beschwerden nach ein paar Tagen wieder verschwunden.
Bei einigen Menschen, die auf Insektengift allergisch reagieren, kann es zu sehr heftigen Reaktionen kommen. Symptome sind großflächige Rötung und Schwellung, ausgeprägte Nesselsucht, Fieber, Erbrechen, Atemnot bis zum Kreislaufkollaps (so genannter anaphylaktischer Schock). Wenn dieser Verdacht besteht oder eine Allergie bekannt ist, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Am besten tragen gefährdete Menschen ein so genanntes Notfallset bei sich.
Durch Kratzen oder wenn die Einstichstelle nicht hygienisch sauber ist, riskiert man eine Infektion durch Bakterien. Der Stich heilt dann besonders schlecht ab, entzündet sich und fängt an zu nässen.
Viele Insekten können Krankheiten übertragen. Von den "Einheimischen" zählt dazu vor allem die Wespe, die Bakterien oder auch Tetanus verschleppen kann. Der bekannteste Überträger in tropischen Gebieten ist die Anopheles-Mücke. Sie kann mit Malaria infizieren.
Was kann noch dahinter stecken? - Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen
Immer, wenn die Haut mit einer Entzündung reagiert, kommt es zu Rötung, Schwellung, oft auch Juckreiz. Meist lässt sich ein Insektenstich recht gut erkennen, da es eine Einstichstelle und eine klar begrenzte Reaktionszone gibt. Bei größerer Ausdehnung, Quaddelbildung oder auch, wenn viele "Stichstellen" auftreten, sollte man abklären, was dahinter steckt.
Was rät die Großmutter? - Hausmittel und Verhaltenstipps
- Bei Bienenstichen den Stachel mit der Giftblase möglichst vorsichtig mit Pinzette, Fingernagel oder Plastikkarte entfernen. Sinnvoll ist es einen Saugstempel zu benutzen, um das Gift herauszuziehen. Er sieht aus wie eine Spritze, funktioniert nur umgekehrt. Über dem Einstich platzieren und Kolben nach oben ziehen. So wird das Gift abgesaugt.
- Ganz wichtig ist es die Einstichstelle zu desinfizieren, auch Waschen mit Wasser und Seife erfüllt diesen Zweck.
- Kühlung mit kaltem Wasser, verdünntem Alkohol, essigsaurer Tonerde oder den Stich mit Salmiakgeist betupfen, frisch geschnittene Zwiebel auf dem Stich verreiben, mit Speichel befeuchten und Zucker darauf verreiben.
- Bei frischen Stichen das betroffene Körperteil ruhig halten, dann wird die Schwellung nicht so groß.
- Vorsicht bei Stichen am oder im Mund-Rachenraum. Eiswürfel lutschen oder sofort einen Teelöffel Kochsalz mit wenig Wasser anfeuchten und langsam schlucken. Schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.
- Juckreizstillende Gele sind sinnvoll, um die Gefahr einer Infektion durch Kratzen zu verringern.
- Bei infizierten Stichen Kamillentinktur auftragen. Auch Teebaumöl kann man auftupfen, das sollte aber verdünnt werden.
Bearbeitungsstand: 02.11.2021
Quellenangabe:
Moll, Dermatologie, (2010), 7. Auflage
Die Information liefert nur eine kurze Beschreibung des Krankheitsbildes, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie sollte keinesfalls eine Grundlage sein, um selbst ein Krankheitsbild zu erkennen oder zu behandeln. Sollten bei Ihnen die beschriebenen Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
Dosierung und Anwendungshinweise
Wie wird das Arzneimittel dosiert?
Wie wird das Arzneimittel dosiert?
| Wer | Einzeldosis | Gesamtdosis | Wann |
|---|---|---|---|
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene | eine ausreichende Menge | mehrmals täglich | verteilt über den Tag |
Anwendungshinweise
Art der Anwendung?
Tragen Sie das Arzneimittel auf die betroffene(n) Hautstelle(n) auf. Massieren Sie das Arzneimittel danach leicht ein. Waschen Sie nach der Anwendung gründlich die Hände. Vermeiden Sie den versehentlichen Kontakt mit Schleimhäuten, Augen und offenen Hautstellen.
Dauer der Anwendung?
Ohne ärztlichen Rat sollten Sie das Arzneimittel nicht länger als 1-2 Wochen anwenden. Bei länger anhaltenden oder regelmäßig wiederkehrenden Beschwerden sollten sie Ihren Arzt aufsuchen.
Überdosierung?
Bei einer Überdosierung kann es unter anderem zu Juckreiz und Hautrötungen kommen. Setzen Sie sich bei dem Verdacht auf eine Überdosierung umgehend mit einem Arzt in Verbindung.
Anwendung vergessen?
Setzen Sie die Anwendung zum nächsten vorgeschriebenen Zeitpunkt ganz normal (also nicht mit der doppelten Menge) fort.
Generell gilt: Achten Sie vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern und älteren Menschen auf eine gewissenhafte Dosierung. Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach etwaigen Auswirkungen oder Vorsichtsmaßnahmen.
Eine vom Arzt verordnete Dosierung kann von den Angaben der Packungsbeilage abweichen. Da der Arzt sie individuell abstimmt, sollten Sie das Arzneimittel daher nach seinen Anweisungen anwenden.
Art der Anwendung?
Tragen Sie das Arzneimittel auf die betroffene(n) Hautstelle(n) auf. Massieren Sie das Arzneimittel danach leicht ein. Waschen Sie nach der Anwendung gründlich die Hände. Vermeiden Sie den versehentlichen Kontakt mit Schleimhäuten, Augen und offenen Hautstellen.
Dauer der Anwendung?
Ohne ärztlichen Rat sollten Sie das Arzneimittel nicht länger als 1-2 Wochen anwenden. Bei länger anhaltenden oder regelmäßig wiederkehrenden Beschwerden sollten sie Ihren Arzt aufsuchen.
Überdosierung?
Bei einer Überdosierung kann es unter anderem zu Juckreiz und Hautrötungen kommen. Setzen Sie sich bei dem Verdacht auf eine Überdosierung umgehend mit einem Arzt in Verbindung.
Anwendung vergessen?
Setzen Sie die Anwendung zum nächsten vorgeschriebenen Zeitpunkt ganz normal (also nicht mit der doppelten Menge) fort.
Generell gilt: Achten Sie vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern und älteren Menschen auf eine gewissenhafte Dosierung. Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach etwaigen Auswirkungen oder Vorsichtsmaßnahmen.
Eine vom Arzt verordnete Dosierung kann von den Angaben der Packungsbeilage abweichen. Da der Arzt sie individuell abstimmt, sollten Sie das Arzneimittel daher nach seinen Anweisungen anwenden.
Zusammensetzung
Was ist im Arzneimittel enthalten?
Die angegebenen Mengen sind bezogen auf 1 g Creme.
Was ist im Arzneimittel enthalten?
Die angegebenen Mengen sind bezogen auf 1 g Creme.
| Wirkstoffstoff | 100 mg | Arnikablüten-Extrakt (1:3,5-4,5); Auszugsmittel: Sonnenblumenöl |
| Hilfstoff | + | Tocopherolgemisch |
| Hilfstoff | + | Phospholipide aus Sojabohnen, entölt |
| Hilfstoff | 30 mg | Cetylstearylalkohol, emulgierender (Typ A) |
| Hilfstoff | + | Glycerolmonooleat |
| Hilfstoff | + | Glycerol 85% |
| Hilfstoff | + | Wasser, gereinigtes |
| Hilfstoff | 25 mg | Cetylalkohol |
| Hilfstoff | + | Stearinsäure |
| Hilfstoff | 10 mg | Benzylalkohol |
Kundenrezensionen
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke.
**gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.
GPSR-Informationen:
Kneipp GmbH
Strasse: Winterhäuser Str.85
PLZ / Ort: 97084 Würzburg
Land: Deutschland
Webseite: www.kneipp.de
Telefonnummer: +49 931 80020
Email: info@kneipp.de
Kneipp GmbH
Strasse: Winterhäuser Str.85
PLZ / Ort: 97084 Würzburg
Land: Deutschland
Webseite: www.kneipp.de
Telefonnummer: +49 931 80020
Email: info@kneipp.de
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Diese Artikel wurden oft angesehen: